von Steffen Körber


In diesem Jahr erfüllte ich mir einen lang ersehnten Traum und bereiste Island – eines der bei Fotografen zurzeit wohl gefragtesten Reiseziele. Während meines zehntägigen Aufenthalts im Süden der Insel sammelte ich nicht nur wunderbare Eindrücke, sondern vor allem auch Erkenntnisse über mich als Fotografen und über die Reisefotografie als Genre. Denn obwohl sich mir ein Land offenbarte, das atemberaubende Landschaften und eine faszinierende Tierwelt zu bieten hat, machte sich in mir gleich in mehrerer Hinsicht eine Enttäuschung breit, die ich zunächst gar nicht richtig verstehen konnte. Jetzt, nach der Reise, glaube ich die Ursachen gefunden zu haben: Ich bin mit zu hohen oder falschen Erwartungen an die Reise herangegangen und war nicht optimal vorbereitet. Die Erkenntnisse, die ich im einzelnen gewonnen habe, sind sicherlich keine Geheimnisse und mögen für manche sogar trivial erscheinen. Für mich sind sie jedoch wertvoll – und sie lassen sich auf jedes Reiseziel gleichermaßen anwenden. Aus diesem Grund möchte ich an dieser Stelle einige Fotoreise-Tipps abgeben.
Im Wesentlichen habe ich mich aus zwei Gründen für Island als Reiseziel entschieden. Zum einen erfreue ich mich an der Natur und finde Ruhe dabei, mich in ihr zu bewegen. Zum anderen zählen Tier- und Landschaftsfotografie zu den Leidenschaften, denen ich gerne nachgehe und die ich zu meinen fotografischen Schwerpunkten zähle.
Island liegt momentan im Trend. Das trifft nicht nur auf Outdoor-Liebhaber im allgemeinen, sondern auch auf Fotografen zu. Und daher findet sich im Internet natürlich auch eine Fülle an Fotos und Videos aus Island. Im Vorfeld meiner Reise habe ich daher nicht nur einige interessante Reiseberichte gelesen, sondern mir auch Videos und Vlogs auf YouTube angeschaut und eine riesige Anzahl faszinierender Bilder auf Onlineplattformen betrachtet.
Besonders die Bilder bauten in mir eine gewisse Erwartung auf, wie Island aussehen würde. Wie selbstverständlich nahm ich sie als ›Vorlage‹ dafür, wie ich Island fotografisch gerne einfangen wollte. Die Faszination, die ich noch am ersten Tag vor Ort verspürte, wurde leider schnell von einer gewissen Enttäuschung verdrängt. Eine Enttäuschung darüber, wie ›unspektakulär‹ Island im Vergleich zu diesen Bildern aussieht, die ich gesehen hatte. Das ist keinesfalls despektierlich gemeint: Island ist wunderschön und definitiv eine Reise wert. Es fällt nicht schwer, geeignete Motive zu finden und mit dem richtigen Blick und fotografischem Können sind tolle Bilder garantiert. Aber man sollte hinsichtlich der von anderen Bildern beeinflussten Erwartungen Folgendes beachten:
Beim Betrachten fremder Bilder ist einem oft nicht klar, dass sie lediglich einen (wohlüberlegten) Ausschnitt aus der Realität zeigen. Das Drumherum wird gezielt ausgeblendet: Man sieht keine Reisebusse, keine Parkplätze, keine Abfälle und keine Häuschen, an denen man Eintritt entrichten muss. Genau das wird an Sehenswürdigkeiten aber immer mehr zur Realität. Man sieht nicht, dass vieles, was wir zunächst als besonders (weil exotisch) ansehen, über eine Strecke von 100 km irgendwann vielleicht nur noch monoton wirkt.
Und dann wäre noch die Sache mit den anderen Touristen, die sich ebenfalls an den einschlägigen Sehenswürdigkeiten aufhalten und sich dabei unwillkürlich ins Bild drängen. Diese sieht man auf den atemberaubenden Fotos auch nicht.
Wenn man auf Reisen ist, besteht natürlich immer die Gefahr, ›schlechtes‹ Wetter zu erwischen. Und da man sich nur für eine begrenzte Zeit am Reiseziel aufhält, herrscht mit etwas Pech auch über die gesamte Dauer hinweg schlechtes Wetter. Mit schlechtem Wetter meine ich nicht unbedingt Unwetter – denn das ist zwar unangenehm, kann aber fotografisch gesehen sehr interessant sein. Was ich meine, ist beispielsweise ein trister, wolkenloser grauer Himmel oder starker Nebel, der das Fotografieren zwar nicht unmöglich macht, aber ab einem gewissen Grad doch irgendwie sinnlos erscheinen lässt.
Derartiges erlebte ich beispielsweise am dritten Tag, als ich das Kap Dyrhólaey in der Nähe von Vík í Mýrdal besuchte. Mir bot sich eine einzige Nebelwand, als ich mich vom Parkplatz aus auf den Gipfel aufmachte. Bei etwa einem Meter Sicht und kaum Aussicht auf Besserung waren alle anderen Touristen enttäuscht wieder weitergefahren. Da ich allerdings keine Chance ungenutzt lassen wollte, Papageientaucher zu sehen, und hoffte, dass sich der Nebel noch verziehen würde, wanderte ich zum Gipfel. Gerade als ich ankam, öffnete sich für wenige Minuten die Nebelwand und ermöglichte einen wunderschönen Blick auf den Torbogen (Abb. 2). Ich war im wahrsten Sinne des Wortes zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Für den Rest des Tages sollte das aber die einzige Ausbeute gewesen sein.
In diesem Moment wurde mir etwas Triviales klar: Es bietet sich nicht immer die Chance auf atemberaubendes Licht, es besteht auch keine Garantie, gutes (oder besser: interessantes) Wetter zu haben. Vieles in der Reisefotografie hängt einfach nur mit Glück zusammen.
Selbstverständlich sieht man aber nur die gelungenen Bilder, die unter diesen ›glücklichen‹ Umständen entstanden sind. Denn wer stellt schon gerne langweilige Bilder online? Oder aus welchem Grund sollten diese im Vergleich zu den atemberaubenden Bildern eine Sichtbarkeit erzielen?
Abgesehen von den Wetter- und Lichtverhältnissen der jeweiligen Aufnahme kann man auch nicht immer einschätzen, wie sehr bei den Bildern nachträglich in Photoshop, Lightroom und Co. nachgeholfen wurde. Bei Landschaftsaufnahmen wird meiner Meinung nach oft stärker nachbearbeitet als man es von diesem Genre eigentlich erwarten würde. Warum? Vielleicht einfach nur, weil es mittlerweile jeder kann. Oder vielleicht, weil es erwartet wird?
Auffällig ist jedenfalls, dass Farben oft sehr intensiv dargestellt, Bereiche künstlich aufgehellt oder abgedunkelt werden, der Kontrast stark erhöht und der ›magische‹ Regler Dunst verringern etwas übereifrig angewandt wird. Das alles ist natürlich legitim. Die so bearbeiteten Bilder zeigen dann jedoch etwas, das es so im Moment der Aufnahme eigentlich gar nicht gab – und das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Denn sonst entstehen falsche Erwartungshaltungen, die man selbst auf seine Bilder überträgt. Möchte man dann mit anderen Bildern ›konkurrieren‹, ist man verleitet, seine Bilder in ähnlicher Weise zu überarbeiten, so dass sich der Kreis schließt und man diese falsche Erwartung schließlich selbst bestätigt.
Die Erwartungshaltung wird aber nicht nur durch externe Einflüsse aufgebaut, sondern auch durch das, was man sich selbst gezielt vornimmt. Nachdem ich mangels sorgfältiger Recherche vor einigen Jahren bereits zur ›falschen Zeit‹ in Irland war, um Papageientaucher zu sehen, habe ich meine Islandreise unter anderem nach dem Zugverhalten der Papageientaucher geplant. Obwohl diese in den vergangenen Jahren immer bereits Ende April auf der Insel eintrafen, bekam ich Anfang Mai selbst nach mehrmaligen Besuchen der einschlägigen Plätze nicht einen einzigen Papageientaucher zu Gesicht.
In der Hoffnung auf tolle Aufnahmen habe ich mich vor der Reise dazu entschlossen, eine 600-mm-Festbrennweite mit auf die Insel zu nehmen. Da Island mit seinen zahlreichen Vogelfelsen und umliegenden Inseln fast überall Brutplätze für Papageientaucher bietet, hatte ich das Objektiv praktisch immer im Rucksack, um allzeit bereit zu sein. Entsprechend schwer hatte ich auch bei jeder Wanderung zu schleppen.
Ich war an den ersten beiden Vogelfelsen zunächst sehr enttäuscht, dass ich keine Gelegenheit bekam, die Vögel zu fotografieren. Und ich war frustriert darüber, die ganze Ausrüstung immer wieder vergeblich mit mir herumgeschleppt zu haben. Doch als ich dann erneut an einem Vogelfelsen stand und um mich herum Möwen und Küstenseeschwalben flogen, fragte ich mich, warum ich eigentlich nicht auf die Idee gekommen war, stattdessen diese oder die zahlreichen Austernfischer zu fotografieren, die überall unerschrocken am Straßenrand nach Futter suchten. Ich stellte fest, dass ich regelrecht mit Scheuklappen durch die Gegend lief und nach dem suchte, was ich mir im Vorfeld als spektakulärstes Motiv auserkoren hatte. Dabei ließ ich aber völlig außer Acht, dass die Tierwelt Islands nicht auf eine einzelne Vogelart beschränkt ist und andere Tiere ebenfalls wunderbare Motive abgaben.
Ähnlich verhält es sich übrigens auch mit den sogenannten Sehenswürdigkeiten. Unabhängig davon, ob diese vielleicht schon ›zu oft‹ fotografiert worden sind als dass man etwas Neues zeigen könnte, wurde mir bewusst, dass die Klassifizierung teilweise nach Superlativen, teilweise auch nach völliger Willkür vollzogen zu sein schien. Island bietet – wie andere Reiseziele natürlich auch – weit mehr als eine kleine Auswahl an schönen Plätzen, Wasserfällen oder Felsformationen.
Es lohnt sich immer, Ausschau nach geeigneten Motiven zu halten. An dem kleinen Wasserfall, den die Abbildungen 3 und 4 zeigen, wäre ich beinahe ebenso vorbeigefahren, wie es die anderen Touristen getan haben. Je bewusster mir aber wurde, dass sich geeignete Motive quasi überall finden, desto öfter verspürte ich den Drang, das Auto am Straßenrand abzustellen.
Man sieht auf den Bildern natürlich nicht, welcher Weg nötig ist, um zu ihnen zu gelangen. Für so manches Foto musste ich holprige Straßen passieren oder lange, anstrengende und mitunter gefährliche Wanderungen auf mich nehmen. Auf einen ähnlichen Aspekt ist Jürgen Gulbins übrigens bereits in seinem Artikel ›Die letzte Meile‹ in fotoespresso 2/2017 eingegangen. Ähnlich ging es mir bei dem zuvor genannten Bild des Torbogens im Nebel (Abb. 2). In solchen Momenten vergisst man die Anstrengung, die man für ein besonderes Bild aufbrachte, natürlich gerne. Schließlich nimmt man ein tolles Bild mit nach Hause und hat damit sein Ziel erreicht.
Was man aber gerne ausblendet, sind die vielen Momente, in denen die harte Arbeit vergebens war. Wäre ich nur fünf Minuten später losgefahren, hätte ich auf dem Kap Dyrhólaey nichts als Nebel gesehen. Und was die Papageientaucher angeht – obwohl ich im Laufe der Reise auch andere Tiere fotografierte und mich über die Ergebnisse beim Betrachten heute sehr freue, war ich jedes Mal aufs Neue enttäuscht, wenn ich wieder vergebens einen Platz aufsuchte, an dem ich mir Papageientaucher erhoffte. Insofern musste ich mir während dieser Enttäuschungen erst einmal bewusst machen, dass es keinesfalls eine Garantie gibt, etwas Bestimmtes zu sehen und erfolgreich zu fotografieren. Egal, ob es sich dabei um Naturphänomene wie Polarlichter oder das Antreffen bestimmter Tiere handelt: Vieles lässt sich (wie auch das Wetter) einfach nicht beeinflussen.
Was mir auf der Reise auch klar wurde ist, dass ich entweder Urlaub oder eine Fotoreise mache und nicht den Anspruch habe, beides miteinander zu kombinieren. Wenn ich in Urlaub fahre, geht es (je nach Reiseziel) in erster Linie entweder darum, ein Land und die Kultur kennenzulernen, etwas zu erleben oder mich zu erholen und es mir ›gutgehen‹ zu lassen. Fotos macht man dabei eher beiläufig. Das muss nicht bedeuten, dass die Bilder nicht doch ganz passabel werden, aber man wird nicht mit allen Mitteln das oder jenes in diesem oder jenem Licht fotografieren und dafür die große Ausrüstung mitschleppen wollen. Mache ich dagegen eine Fotoreise, geht es mir in erster Linie um die Bilder.
Zwar schließt sich beides nicht grundsätzlich aus, aber die Prioritäten liegen (mitunter weit) auseinander. Wie ich bereits erwähnte, sind Hartnäckigkeit und Ausdauer nötig, um zu guten Bildern zu gelangen. Nur die wenigsten können oder möchten das mit den Erwartungen an einen Urlaub kombinieren. Denn wenn man teilweise mitten in der Nacht unterwegs ist, große Strapazen in Kauf nimmt und stundenlang an einem Ort verbringt, um am Ende genau DAS Foto zu machen, wird man zwar in fotografischer Hinsicht sehr zufrieden sein, wenn es geklappt hat – aber der Weg dahin gestaltet sich anstrengend. Im Zweifelsfall muss man sich also vorher genau überlegen, was man möchte. Einen Urlaub fotografisch dokumentieren und spontan mit kleineren Mitteln fotografieren oder mit großem Equipment gezielt das bestmögliche Ergebnis anstreben.
Ich habe auf meiner Islandreise beides vereinen wollen – und das ging schief! Ich habe Island zum ersten Mal bereist, wollte dort Urlaub machen und mit herausragenden Fotos nach Hause kommen. Das führte dazu, dass ich mit zu viel Ausrüstung unterwegs war, um einen ›unbeschwerten‹ Urlaub genießen zu können, und dass ich mit zu wenig Zeit (fürs Fotografieren) und Ausrüstung unterwegs war, um die Bilder zu machen, die ich eigentlich gerne gehabt hätte. Dementsprechend war die Enttäuschung vorprogrammiert.
Das bringt mich direkt zum Thema ›Vorbereitung‹. Gute Vorbereitung beginnt schon lange vor der Reise zu Hause in Form von Recherche und beim Zusammenstellen der geeigneten Ausrüstung. Möchte ich eine Fotoreise machen und kommt es mir auf die Qualität der Bilder an, darf ich vielleicht nicht zu große Kompromisse eingehen.
Ich hatte für Landschaftsaufnahmen mein kleinstes (und schwächstes) Stativ ausgewählt und mich für NoName-Filter aus Fernost entschieden, die ich vorher nicht einmal getestet hatte. Für die große Brennweite hatte ich nur ein Einbeinstativ eingepackt.
Vor Ort zeigte sich, dass ich aufgrund des oftmals vorherrschenden starken Winds das Objektiv mit dem Einbeinstativ nicht gut stabilisieren konnte und dass das kleine Dreibeinstativ sogar zu wacklig für die Landschaftsaufnahmen war. Zu allem Übel waren die ND-Filter auch keine große Hilfe bei meinem Vorhaben, lange Verschlusszeiten zu erhalten. Die Stärke der ND-Filter war geringer als angegeben und darüber hinaus erhielten meine Bilder durch sie einen Farbstich, den ich nur durch zeitraubende Bearbeitung wieder entfernen konnte. Eigentlich hätte ich auf mein stabiles (aber deutlich schwereres) Dreibeinstativ setzen und es zusätzlich zu meinem sperrigen Teleneiger in den Koffer packen sollen. Und ich hätte etwas mehr Geld in vernünftige Filter investieren sollen.
Wenn man sich für eine Fotoreise entscheidet, ist es sinnvoll, sich vor Ort auszukennen. Man kann sich hierzu im Vorfeld vorbereiten, über Land und Leute lesen und recherchieren, wann und wo die Sonne auf- und untergeht. Damit erhält man je nach Informationslage einen ersten Überblick und theoretisches Wissen, das als Grundlage für eine Planung dienen kann. Leider sind gerade in Diskussionsforen und Bewertungsportalen oft Kommentare mit ganz unterschiedlichen Meinungen vertreten. Die Gefahr ist also trotzdem groß, einzelne Aspekte falsch einzuschätzen. So erging es mir gleich in mehrerer Hinsicht.
Ich hatte beispielsweise gelesen, dass die Straßen, die ins Hochland führen, nur mit Allradfahrzeugen befahren werden dürfen und folgerte daraus, dass man alle anderen Straßen problemlos mit einem normalen PKW befahren kann. Das darf man zwar theoretisch – ich hatte allerdings keine Vorstellung davon, was man in Island unter normalen Straßen versteht und in welchem Zustand sie sind – ganz zu schweigen von den vielen Schotterstraßen. Entgegen meiner Erwartung konnte ich einige Straßen mit dem PKW nicht passieren, was mich schließlich zum spontanen Umplanen zwang.
Das war im Grunde kein Problem, weil ich entgegen meiner Erwartung trotzdem recht schnell alle Orte besucht hatte, die ich mir bis dahin vorgenommen hatte und entsprechend mehr Zeit für eine Wanderung entlang der nicht passierbaren Straße zur Verfügung hatte. Das ergab sich, weil ich nicht genau einschätzen konnte, wie lange ich mich jeweils dort aufhalten würde und wie lange ich jeweils für die Fahrt brauchte.
Wenn ich das nächste Mal nach Island reise, werde ich mit Sicherheit ein geländetaugliches Fahrzeug nutzen und kann außerdem besser einschätzen, wie viel Zeit ich für die Fahrt und den Aufenthalt an bestimmten Orten benötige.
Vieles von dem, was ich hier anspreche, hielt ich eigentlich für selbstverständlich – bis ich mich dabei erwischte, doch beinahe allem zu widersprechen. Das veranlasste mich dazu, meine Erwartungen zu hinterfragen und schließlich diesen Artikel zu schreiben. Ich denke, dass man sich vieles davon auch immer wieder vergegenwärtigen muss, um am Ende nicht wegen zu hoher oder unrealistischer Erwartungen enttäuscht zu werden.
Übrigens nehme ich meine Islandreise im Nachhinein keineswegs als Enttäuschung wahr. Ich bin mit der Ausbeute nun sogar recht zufrieden. Viel wichtiger ist für mich aber, dass ich weitere Reisen mit einer anderen Erwartungshaltung angehe und mich anders darauf vorbereiten werde. Ich werde sicherlich noch einmal nach Island fliegen, mich dann jedoch nur auf das Fotografieren konzentrieren und weiterhin hoffen, irgendwann einmal Pagageientaucher fotografieren zu können. Aber ich werde nicht mehr enttäuscht sein, wenn ich sie nicht antreffe, sondern offen für das sein, was sich mir sonst noch bietet – selbst, wenn am Ende nur wenige oder gar keine Fotos entstehen.
Dieser Artikel erschien auch in fotoespresso 3/2017
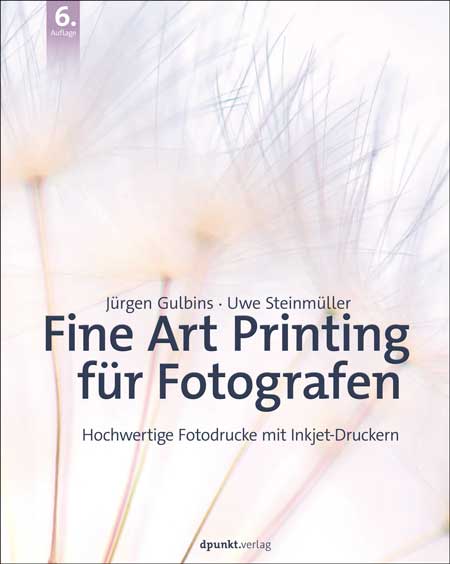









Konnte ihrem ehrlichen Artikel viel entnehmen und eigene Erfahrungen bestätigt finden. Vielen Dank dafür!
Der Artikel spricht mir aus dem Herzen!
Als ich bin Neueinsteigerin in der Fotografie und es macht mir unheimlich Spaß, nur Schade das ich nicht immer tolle Fotos hin bekomme.
Lg Lisa
Offene, ehrliche Worte, die ich sehr hilfreich finde. Vielen Dank.